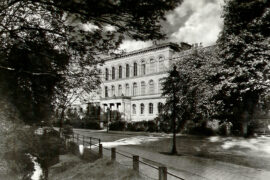Austausch, Diskussion, Auseinandersetzung, soziale Interaktion – all dies sind Formen des sozialen Miteinanders, die für das wissenschaftliche Arbeiten von Bedeutung sind. Dabei gelten häufig unausgesprochene Regeln und Verhaltensnormen, die den Umgang miteinander prägen. Was aber, wenn diese schwerfallen und ihr Einhalten nicht gelingt? Wenn sich Hürden auftun und das soziale Miteinander nicht als Bereicherung, sondern als Stress erlebt wird?
Um diese und viele weitere Fragen ging es bei der ersten Veranstaltung der Reihe Interaktion neu denken. Wege zu einer vielfältigeren Wissenschaftskultur. Zu der Vortragsreihe, die die Möglichkeiten einer diverseren und offeneren Wissenschaftskultur ausloten möchte, lädt der Sonderforschungsbereich Kognition der Interaktion ein. Im Rahmen von Podiumsdiskussionen sollen dabei beispielhaft Vertreter*innen verschiedener Gruppen zu Wort kommen.
Der erste Termin ist gut besucht. Es geht um das Thema Neurodivergenz – wenn Hürden nicht offensichtlich sind. Auf dem Podium sitzen „Betroffene“ ebenso wie Interessenvertreterinnen und Forschende. Für die unterschiedlichen Perspektiven konnten zum aktuellen Termin Imke Heuer, wissenschaftliche Mitarbeiterin mit Autismusdiagnose, Katrin Lux, Beauftragte für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, Katrin Reich, Professorin für Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Menschen mit Beeinträchtigungen sowie Marcella Woud, Professorin für Klinische Psychologie und Experimentelle Psychopathologie gewonnen werden. Moderiert wird das Gespräch von Elena Everding vom Göttinger Tageblatt.

Anschaulich erzählt Imke Heuer mit welchen Hürden sie während ihres Studiums zu kämpfen hatte. Als sie die Diagnose Autismus erhielt, war sie bereits über 30 Jahre alt. Zwar war der Begriff Autismus ihr da schon lange bekannt und schien ihr auch in mancher Hinsicht vertraut. Was sie jedoch gar nicht auf sich beziehen konnte, war die enge Verbindung, die zwischen Autismus und kognitiver Beeinträchtigung gezogen wurde. Von Neurodiversität und Autismus-Spektrum-Störung ohne intellektuelle Beeinträchtigungen sollte sie erst viel später erfahren.
Während ihres Studiums erlebt sie große Begeisterung für die Wahl ihrer Studienfächer Anglistik und Geschichte, aber ebenso Ängste und Abwertungsgedanken, die sie an sich selbst zweifeln lassen. Die unklare Berufsperspektive und die Empfehlung als Geisteswissenschaftlerin über Praktika einen informellen Einstieg in die Berufswelt zu finden, bereiten ihr große Probleme. Ihre Entscheidung, für den Master nach England zu gehen, erweist sich im Nachhinein für sie als Glücksgriff. Der äußere Rahmen dort ist sehr viel kleiner und enger betreut und die fast familiäre Unterstützung hilft ihr, wieder an sich selbst zu glauben. Durch die Bologna-Reform haben sich diese Rahmenbedingungen mittlerweile auch in Deutschland stark verändert. Für Imke Heuer bleibt jedoch durch ihre Erfahrungen in den Anfangsjahren ihres Studiums die Erkenntnis, dass viele autistische Menschen trotz hoher Motivation und vieler Fähigkeiten in der Wissenschaft scheitern, weil sie dort nicht Fuß fassen können.
Diese Erfahrung kennt auch Katrin Lux aus Beratungsgesprächen. Wenn das Fragen schwerfällt, wenn die Einordnung von Antworten nicht gelingt oder wenn die Reizfilterung nicht funktioniert, dann kann ein Tag an der Uni zur scheinbar unüberwindbaren Herausforderung werden. Nicht selten kommt es dann zu Schneeballeffekten, wenn zum Beispiel in der Folge die Regelstudienzeit nicht eingehalten werden kann.
Dabei handelt es sich nicht um ein Randproblem. Neuere Forschungen legen nahe, dass die Häufigkeit von Autismus weltweit mit 0,6 bis 1 Prozent anzunehmen ist, wohingegen immerhin 15 bis 20 Prozent der Menschen als neurodivergent gelten. Den deutlich breiter verstandenen Begriff der Neurodivergenz erläutert Marcella Woud als ein Erklärungsmodell, dem es darum geht, Prozesse, die im Gehirn eines Menschen ablaufen, in ein Spektrum einzuordnen. Entscheidend ist dabei, die ganze Bandbreite abzudecken, in der sich Menschen beispielsweise hinsichtlich Aufmerksamkeit, Wahrnehmung oder Reizverarbeitung unterscheiden.
Was könnte neurodivergenten Menschen helfen, damit Schwierigkeiten oder Unsicherheiten im sozialen Kontext nicht zu einer Abwärtsspirale mit zusätzlichen Symptomen wie Depression oder Angststörungen führen? In der Diskussion werden für den universitären Bereich äußere Rahmenbedingungen genannt: ein klar definierter organisatorischer Rahmen, das Festlegen von eindeutigen Zielen, aber eine größere Freiheit dabei, wie diese Ziele erreicht werden können, sowie unterstützende Angebote durch Formate wie zum Beispiel die „Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten“ oder „Buddy“-Systeme. Vor allem aber sind Verständnis und Akzeptanz entscheidend, damit trotz Hürden der Aufbau eines Netzwerks oder eines Freundeskreises gelingen kann.
Ähnliches gilt für den Schritt von der Uni ins Berufsleben. In diesem Kontext interessant sind Befragungen von Arbeitgebern, die Prof. Reich durchgeführt hat, um Spezifika der Zusammenarbeit mit neurodivergenten Beschäftigten zu klären. Sie zeigen zum einen wie wichtig es ist, dass Ziele und Arbeitsaufträge klar formuliert werden – beispielsweise berichtete ein Arbeitgeber aus der IT-Branche, dass ein autistischer Mitarbeiter auf Grund einer ungenauen Aufgabenstellung nicht wie gewünscht einen einzelnen Softwarefehler korrigierte, sondern gleich das komplette Programm umschrieb. Von entscheidender Bedeutung ist ebenso, bei der Einbindung neurodivergenter Beschäftigter ins Team die Kolleg*innen mitzunehmen, um einen offenen und transparenten Umgang mit den unterschiedlichen Bedürfnissen und Anforderungen zu finden. Nur so kann langfristig das Reden mit- und nicht übereinander gelingen.

Zu genau diesem Ziel trägt eine Veranstaltung wie diese ihren Teil bei – und lässt schon jetzt gespannt auf die beiden Folgetermine blicken: am 27. Februar 2025 geht es um das Thema Gleichstellung der Geschlechter – wie man althergebrachte Barrieren überwindet. Am 12. März 2025 findet der dritte und letzte Termin der Reihe zu First Generation Academics statt. Er geht der Frage nach, wie das Elternhaus die Karrierewege von Nachwuchswissenschaftler*innen beeinflusst.